GLP-1-Agonisten bei Long-COVID und ME/CFS: Evidenz, Mechanismen und klinische Perspektiven
- Dr. med. Kristina Schultheiß

- 21. Juli 2025
- 12 Min. Lesezeit

Long-COVID und Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom (ME/CFS) sind komplexe, oft überschneidende Krankheitsbilder, für die es bisher keine etablierten medikamentösen Therapien gibt. Patienten leiden unter anhaltender Erschöpfung, neurokognitiven Störungen („Brain Fog“), Schmerzen, orthostatischen Problemen und weiteren Symptomen.
In jüngster Zeit rückt eine unerwartete Medikamentengruppe in den Fokus: GLP-1-Agonisten (Glucagon-like Peptide-1-Rezeptoragonisten wie Semaglutid, Liraglutid, Dulaglutid). Diese ursprünglich als Antidiabetika und Adipositas-Mittel entwickelten Wirkstoffe zeigen vielversprechende Hinweise, dass sie über Gewichtskontrolle hinaus positive Effekte auf Entzündungen, das Immunsystem und das Nervensystem haben könnten . Dieser Bericht fasst den aktuellen Wissensstand zur möglichen Rolle von GLP-1-Agonisten bei Long COVID und ME/CFS zusammen – von ersten klinischen Erfahrungsberichten über denkbare Wirkmechanismen bis hin zu präklinischen Daten, Risiken und laufenden Studien.
Was sind GLP-1-Agonisten und wofür werden sie angewendet?
GLP-1-Rezeptoragonisten (GLP-1-RA) sind synthetische Analoga des körpereigenen Inkretinhormons Glucagon-like Peptide-1. Sie binden an GLP-1-Rezeptoren in Pankreas, Gehirn, Magen-Darm-Trakt, Herz-Kreislauf- und Immunsystem, sind vor dem abbauenden Enzym DPP-4 geschützt und werden meist einmal täglich oder wöchentlich subkutan injiziert; mit Semaglutid (Rybelsus ®) existiert auch eine orale Form. Zu den zugelassenen Wirkstoffen zählen Exenatid, Lixisenatid, Liraglutid, Dulaglutid, Semaglutid sowie der duale GIP/GLP-1-Agonist Tirzepatid.
Zugelassene Einsatzgebiete (On-Label):
Typ-2-Diabetes: Verbesserung der glykämischen Kontrolle allein oder in Kombination (metforminfrei möglich). Beispiel: Ozempic ® (Semaglutid 0,5–1 mg/Woche).
Gewichtsmanagement bei Adipositas/Übergewicht: Wegovy ® (Semaglutid 2,4 mg/Woche) und Saxenda ® (Liraglutid 3 mg/Tag) sind in der EU/FDA zugelassen für Erwachsene ab BMI 30 kg/m² bzw. ≥ 27 kg/m² + Komorbidität; Wegovy darf seit 2022 auch bei Jugendlichen ab 12 J. eingesetzt werden.
Reduktion kardiovaskulärer Ereignisse: Seit März 2024 ist Wegovy zudem explizit zur Senkung von Herzinfarkt-, Schlaganfall- und CV-Todesrisiko bei übergewichtigen/ adipösen Patienten mit manifester kardiovaskulärer Erkrankung zugelassen – das erste Anti-Obesitas-Medikament mit dieser Indikation.
Wie wirken GLP-1-Agonisten (on-label)?
GLP-1-Rezeptoragonisten entfalten ihre Wirkung über mehrere komplementäre Mechanismen, die sie zu einer hochwirksamen Substanzklasse bei Typ-2-Diabetes und Adipositas machen. Im Zentrum steht die blutzuckersenkende Wirkung, die glukoseabhängig erfolgt: Durch die Aktivierung von GLP-1-Rezeptoren auf pankreatischen β-Zellen wird die Insulinsekretion nur bei erhöhtem Blutzuckerspiegel gesteigert. Gleichzeitig wird die Glukagonfreisetzung aus α-Zellen gehemmt, wodurch die hepatische Glukoseproduktion reduziert wird. Diese duale Wirkung führt zu einer effektiven Senkung des Blutzuckerspiegels, ohne das Risiko signifikanter Hypoglykämien – ein entscheidender Vorteil gegenüber klassischen Antidiabetika.
Darüber hinaus besitzen GLP-1-Agonisten ausgeprägte Effekte auf das Körpergewicht. Sie wirken zentral über Rezeptoren im Hypothalamus und im ventralen tegmentalen Areal (VTA) und vermitteln dort ein verstärktes Sättigungsgefühl. Parallel dazu verzögern sie die Magenentleerung, was zu einer verlängerten postprandialen Sättigung führt und die Nahrungsaufnahme deutlich reduziert. Diese Effekte sind maßgeblich für den bei GLP-1-Analoga beobachteten klinisch relevanten Gewichtsverlust, der bei manchen Patient:innen 10–15 % des Ausgangsgewichts betragen kann.
Ergänzend zeigen GLP-1-Agonisten kardiometabolische Zusatzwirkungen, die über die reine Glukose- und Gewichtsregulation hinausgehen. Sie senken den systolischen Blutdruck, verbessern Lipidparameter (z. B. Triglyzeride) und reduzieren systemische Entzündungsmarker wie CRP. Besonders der Abbau viszeralen Fetts – ein wesentlicher Treiber chronischer Inflammation – gilt als zentraler Beitrag zur Verbesserung des metabolischen Risikoprofils. Diese Effekte zusammen erklären die in mehreren großen Outcome-Studien nachgewiesene Reduktion kardiovaskulärer Ereignisse (Herzinfarkt, Schlaganfall, CV-Tod), die mittlerweile zur Erweiterung der Zulassung geführt hat.
Insgesamt wirken GLP-1-Agonisten somit multifaktoriell: blutzuckersenkend, appetithemmend, gewichtsreduzierend, kardioprotektiv und entzündungsmodulierend – mit einem günstigen Sicherheitsprofil, insbesondere bei übergewichtigen oder metabolisch belasteten Patient:innen.
Aktuelle Evidenz und klinische Erfahrungen
Derzeit liegen noch keine großen klinischen Studien zur Behandlung von Long-COVID oder ME/CFS mit GLP-1-Agonisten vor. Allerdings gibt es erste Fallberichte und Off-Label-Erfahrungen von Ärzten, die vorsichtig optimistisch stimmen. Insbesondere haben einige auf komplexe chronische Erkrankungen spezialisierte Kliniker – z. B. Dr. David Kaufman und Dr. Ilene Ruhoy in den USA – begonnen, GLP-1-Agonisten bei ausgewählten Patienten mit ME/CFS, Fibromyalgie oder Long-COVID einzusetzen. Ihre frühen Ergebnisse beschreiben in einer Untergruppe der Patienten eine deutliche Besserung von Symptomen wie Fatigue, Belastbarkeit, kognitiven Problemen sowie mastzellbedingten Beschwerden.
So berichteten Kaufman und Ruhoy unter anderem von Patienten, die auf niedrig dosiertes Semaglutid (teils nur 0,25–0,5 mg wöchentlich, verglichen mit 1,0 mg+ bei Diabetes/Adipositas) ansprachen. Einige schwer Betroffene konnten nach Jahren extremer Einschränkung wieder Aktivitäten des täglichen Lebens aufnehmen: Eine zuvor an den Rollstuhl gebundene Patientin begann nach einigen Wochen Therapie wieder mit einem Rollator zu gehen, eine andere konnte erstmals seit langer Zeit wieder Restaurants besuchen und sogar Wandern gehen. In einem weiteren Fall verbesserte sich der Zustand einer jungen Ärztin mit schwerem Long-COVID (trotz vorangegangener Therapieversuche wie Plasmapherese) rasch unter dem dualen GLP-1/GIP-Agonisten Tirzepatid, sodass sie vom Bett aufstehen und im Haus umhergehen konnte. Diese teils dramatischen Verbesserungen traten oft innerhalb von 2–4 Wochen ein und waren für die erfahrenden Ärzte erstaunlich klar ausgeprägt. Allerdings betonen die Kliniker, dass nicht alle Patienten ansprechen – wie üblich profitiert nur eine Teilgruppe, und vollständige Heilungen wurden bislang nicht beobachtet. Insgesamt handelt es sich um anekdotische Evidenz, die zwar Hoffnung weckt, aber systematisch überprüft werden muss.
Ein besonders interessanter Fallbericht wurde 2023 publiziert: Eine Patientin mit aggressiver systemischer Mastocytose begann aus Gewichtsgründen Semaglutid zu injizieren – und innerhalb von zwei Wochen verschwanden praktisch alle ihre mastzellbedingten Beschwerden (Fatigue, Flush, Juckreiz, Kopfschmerzen, Ausschläge, chronische Diarrhö). Die Frau berichtete, sie fühle sich „wie ein neuer Mensch“ und habe sich nie besser gefühlt . Auffällig war, dass sich auch ihre chronische Erschöpfung deutlich besserte. Da ihr Übergewicht in dieser kurzen Zeit nur moderat abnahm, wird der Effekt direkt der GLP-1-Wirkung auf Mastzellen/Immunzellen zugeschrieben, nicht bloß der Gewichtsreduktion. Solche Beobachtungen aus Einzelfällen haben in der medizinischen Community für Aufmerksamkeit gesorgt.
Insgesamt gilt: GLP-1-Agonisten sind keine anerkannte Therapie für Long-COVID oder ME/CFS. Jeglicher Einsatz erfolgt off-label und experimentell . Experten mahnen zur Zurückhaltung, bis belastbare Daten vorliegen – gleichwohl sind viele aufgrund der ersten Berichte „vorsichtig optimistisch“. Es laufen Bestrebungen, diese Erfahrungen wissenschaftlich aufzuarbeiten: So bereiten Kaufman/Ruhoy derzeit eine Publikation ihrer Fallserien vor, und in den kommenden Monaten werden weitere Berichte erwartet . Bemerkenswert ist zudem, dass aus der verwandten Erkrankung Fibromyalgie bereits eine tierexperimentelle Studie und eine erste klinische Studie existieren (siehe unten), was den Weg für formelle klinische Prüfungen bei Post-COVID-Syndrom und ME/CFS ebnen könnte. Eine Hoffnung ist, dass angesichts des Booms der GLP-1-Medikamente die Industrie oder Forschungsförderung bis 2030 auch gezielte Studien in Long-COVID oder ME/CFS ermöglicht.
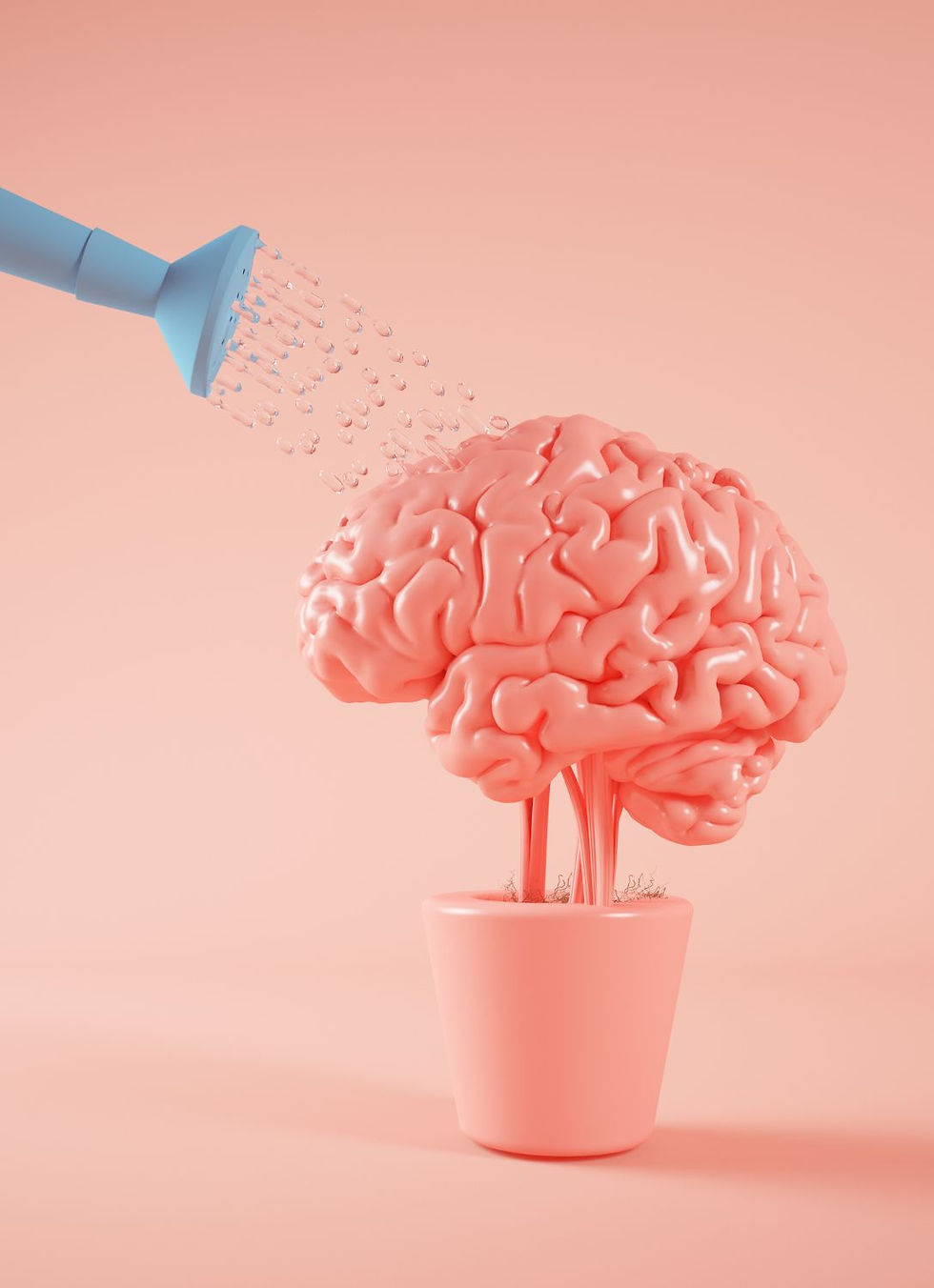
Geplante Studien zum Einsatz von GLP-1-Agonisten bei Long COVID und ME/CFS
Obwohl bislang keine randomisierten kontrollierten Studien (RCTs) speziell zur Anwendung von GLP-1-Agonisten bei ME/CFS vorliegen, beginnt sich die Studienlandschaft im Bereich Long-COVID dynamisch zu entwickeln. Besonders im Fokus steht dabei der Einsatz bei Patient:innen mit kognitiven Einschränkungen und metabolischen Begleiterkrankungen.
Eine der derzeit relevantesten Untersuchungen ist eine Phase-II-Studie unter der Leitung der University of Chicago, in der Liraglutid (1,8 mg/Tag) zur Behandlung von kognitiven Symptomen bei Long COVID geprüft wird (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT06171152). Eingeschlossen werden Patient:innen mit dokumentiertem „Brain Fog“ nach SARS-CoV-2-Infektion sowie einem BMI ≥ 27 kg/m². Ziel der Studie ist es, die Wirkung auf neurokognitive Funktionen sowie Biomarker für Entzündung und Neuroprotektion (z. B. BDNF) zu untersuchen. Die Rekrutierung begann 2024, erste Ergebnisse werden frühestens 2026 erwartet.
Darüber hinaus haben mehrere Ärzt:innen aus dem Netzwerk MASTERMinds (u. a. Dr. David Kaufman, Dr. Ilene Ruhoy) angekündigt, Fallserien ihrer Long-COVID- und ME/CFS-Patient:innen, die im Off-Label-Setting mit GLP-1-Agonisten behandelt wurden, systematisch auszuwerten. Eine solche retrospektive Fallstudie soll demnächst publiziert werden und könnte wichtige Hinweise auf Ansprechmuster, Dosierung und Verträglichkeit liefern. Parallel dazu bestehen Überlegungen, eine prospektive, kontrollierte Pilotstudie mit Semaglutid bei Patient:innen mit postinfektiöser Fatigue zu initiieren. Bislang ist diese jedoch noch nicht offiziell registriert.
Erwähnenswert ist außerdem eine laufende Studie zur Anwendung von Semaglutid bei Fibromyalgie, die auf vielversprechenden Tierdaten basiert. Da sich Fibromyalgie und ME/CFS symptomatisch und pathophysiologisch stark überschneiden, könnten die Ergebnisse dieser Studie auch für den Long-COVID- und ME/CFS-Bereich von Bedeutung sein.
Insgesamt zeigen diese Entwicklungen, dass sich der klinische Forschungsfokus zunehmend auf neurokognitive, immunmetabolische und entzündungshemmende Eigenschaften von GLP-1-Agonisten bei postviralen Syndromen richtet. Weitere Studien – idealerweise mit klar definierten Subgruppen, Biomarkerstratifizierung und placebokontrolliertem Design – sind dringend erforderlich, um die vielversprechenden Einzelfallberichte systematisch zu validieren.
Für welche Untergruppe von Long-COVID-/ME / CFS-Patient*innen könnte GLP-1 sinnvoll sein?
GLP-1-Agonisten sind nicht für alle Patient:innen mit Long COVID oder ME/CFS gleichermaßen geeignet. Basierend auf pathophysiologischen Überlegungen und ersten klinischen Erfahrungsberichten lassen sich jedoch bestimmte Subgruppen identifizieren, bei denen ein therapeutischer Nutzen besonders wahrscheinlich erscheint. Die folgende Übersicht beschreibt, für welche Patient:innen der Einsatz von GLP-1-Agonisten erwogen werden kann – stets unter Berücksichtigung individueller Kontraindikationen und mit sorgfältigem Monitoring.
Rationale | Charakteristika der Untergruppe | Argumente für GLP-1-RA | Wichtige Hinweise |
Metabolische Dysfunktion | Übergewicht/Adipositas, Insulinresistenz, Dyslipidämie nach SARS-CoV-2 | ausgeprägter Gewichts- und HbA1c-Effekt; Entzündungsreduktion im viszeralen Fett; Senkung kardiovaskulärer Risiken | vorsichtiges Dosis-Einschleichen bei Magen-Darm-Empfindlichkeit |
Mastzell-/Allergie-Phänotyp | MCAS-Symptome (Histaminintoleranz, Flush, Juckreiz) | Fallbericht: Besserungmastozytischer Beschwerden unter Semaglutid; in-vitro-Daten zeigen GLP-1-Rezeptoren auf Mastzellen → Stabilisierung möglich | selten, aber spektakulär; Nutzen bislang nur anekdotisch |
Ausgeprägter Brain-Fog / kognitive Defizite | Subjektive Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, evtl. post-exertionelle Neurofatigue | GLP-1 passiert Blut-Hirn-Schranke, dämpft Mikroglia-Aktivität, erhöht BDNF; Phase-II-Studie (NCT06171152) prüft genau diesen Endpunkt mit Liraglutid | ideal bei BMI ≥ 27; Studienergebnisse frühestens 2026 |
Kardiovaskulärer / Endothelialer Phänotyp | Dysautonomie, Mikrozirkulationsstörungen, ggf. erhöhte CV-Risiken | GLP-1 verbessert Endothelfunktion, senkt MACE-Rate und fördert Muskelperfusion; könnte Orthostase- und PEM-Toleranz erhöhen | Herzfrequenzanstieg (2–4 bpm) monitoren; Hypotonie bei GI-NW vermeiden |
Persistierend diabetische Stoffwechsellage | Neuer Typ-2-Diabetes oder Prädiabetes nach COVID-19 | Standard-Indikation der GLP-1-RA; zusätzliche Antiinflammation kann Long-COVID-Symptome entlasten | Wechselwirkungen mit Insulin/ Sulfonylharnstoffen beachten, Hypoglykämie-Risiko gering, aber vorhanden |
Für wen sind GLP1-Agonisten nicht geeignet?
Die Anwendung von GLP-1-Rezeptoragonisten ist in bestimmten klinischen Konstellationen kontraindiziert oder erfordert besondere Vorsicht. Zu den absoluten Kontraindikationen zählen eine bekannte familiäre oder persönliche Vorgeschichte eines medullären Schilddrüsenkarzinoms (MTC) oder eines multiplen endokrinen Neoplasie-Syndroms Typ 2 (MEN2), da tierexperimentelle Daten auf eine dosisabhängige C-Zell-Hyperplasie unter GLP-1-Agonisten hinweisen.
Ebenfalls ausgeschlossen ist die Therapie bei schwerer Gastroparese oder anderen Magenmotilitätsstörungen, da die Magenentleerung durch GLP-1 zusätzlich verzögert wird. Patient:innen mit akuter oder rezidivierender Pankreatitis sollen aufgrund vereinzelter Fallberichte ebenfalls nicht behandelt werden. Schwangerschaft und Stillzeit gelten als Kontraindikation, da keine ausreichenden Sicherheitsdaten vorliegen.
Bei bestimmten relativen Kontraindikationen oder Risikokonstellationen ist eine individuelle Nutzen-Risiko-Abwägung erforderlich. Dazu gehört insbesondere ein ausgeprägtes Untergewicht oder starker ungewollter Gewichtsverlust, da GLP-1-Agonisten appetithemmend wirken und die Kalorienaufnahme reduzieren. Auch bei Patient:innen mit orthostatischer Dysregulation oder posturalem Tachykardiesyndrom (PoTS) ist Vorsicht geboten, da Übelkeit, Appetitminderung oder Erbrechen eine Dehydratation und damit Kreislaufprobleme verschärfen können.
Eine chronische Niereninsuffizienz mit GFR < 30 ml/min/1,73 m² stellt bei einigen Wirkstoffen eine Kontraindikation dar (z. B. Exenatid), während Liraglutid und Dulaglutid tendenziell besser verträglich sind.
Bei bestehenden Lebererkrankungen oder Gallenblasenproblemen, vor allem im Kontext eines raschen Gewichtsverlusts, ist ein erhöhtes Risiko für Gallensteine zu beachten. Schließlich sollten auch Patient:innen mit depressiven Störungen und begleitender Anorexie oder Appetitlosigkeit engmaschig überwacht werden, da sich diese Symptome unter GLP-1 verstärken können.
Damit bieten GLP-1-Agonisten kein Allheilmittel, wohl aber eine rationale Option für definierte Subgruppen, bei denen das Zusammenspiel von Gewicht, Entzündung, neuro-metabolischer Dysregulation und Mastzellaktivität im Vordergrund steht. Gut designte Studien werden zeigen, wie groß dieser Anteil tatsächlich ist.

Basis- und Verlaufslabordiagnostik bei GLP-1-Therapie
Vor Beginn einer Off-Label-Therapie mit GLP-1-Agonisten – insbesondere bei Long COVID oder ME/CFS – sollte eine sorgfältige Ausgangsdiagnostik erfolgen. Diese dient der Risikobewertung, dem Ausschluss von Kontraindikationen und der Verlaufskontrolle möglicher Nebenwirkungen.
Basisdiagnostik (vor Therapiebeginn):
BMI, Bauchumfang, Blutdruck, Herzfrequenz (auch in Ruhe und bei Lagewechsel)
Leberwerte (GOT, GPT, γ-GT, AP, Bilirubin)
Pankreaswerte (Lipase, ggf. Amylase)
Nierenfunktion (Kreatinin, eGFR, Harnstoff, ggf. Cystatin C)
Elektrolyte (Natrium, Kalium, Magnesium, ggf. Phosphat)
Glukosestoffwechsel (Nüchtern-Glukose, HbA1c, Insulin, HOMA-IR)
Lipidprofil (LDL, HDL, Triglyzeride, Gesamtcholesterin)
Entzündungsmarker (CRP, ggf. IL-6 bei Studieninteresse)
TSH, fT3, fT4 (zur Erkennung endokriner Störungen)
Orthostatische Testung (Schellong oder aktiver Standtest bei PoTS-Verdacht)
Verlaufskontrolle (nach 4–6 Wochen und dann individuell):
Gewichtsdokumentation mit Verlaufskurve
Leber- und Pankreaswerte
Was sind die Nebenwirkungen von GL-1-Agonisten?
Die häufigsten Nebenwirkungen sind gastrointestinale Beschwerden wie Übelkeit, Völlegefühl, Erbrechen oder Durchfall, vor allem zu Therapiebeginn oder bei Dosiserhöhung. Diese sind meist dosisabhängig und vorübergehend. Seltener treten Verstopfung, Gallenerkrankungen oder Pankreatitis auf. Bei bekannter Gastroparese, SIBO oder Reflux ist Vorsicht geboten.
Berichte über neuropsychiatrische Effekte wie Reizbarkeit, Schlafstörungen oder Fatigue-Zunahme existieren, sind aber bislang nicht systematisch untersucht.
In Studien zur Adipositastherapie wurde unter GLP-1-Agonisten ein moderater Verlust an fettfreier Körpermasse (einschließlich Muskulatur) beobachtet. Ob dies auch bei niedriger Dosierung in Long-COVID-/ME/CFS-Kollektiven klinisch relevant ist, ist unklar. Daher sollte auf ausreichende Proteinzufuhr, leichte Bewegung und ggf. Verlaufskontrolle der Muskelmasse geachtet werden.
Welcher GLP-1-Agonist ist zu bevorzugen?
Da der Einsatz von GLP-1-Agonisten bei Long COVID und ME/CFS aktuell off-label erfolgt, gibt es keine standardisierte Empfehlung zur Wahl des Wirkstoffs oder zur Dosierung. Dennoch lassen sich aus klinischer Erfahrung, pharmakologischen Eigenschaften und praktischer Verfügbarkeit begrenzte Empfehlungen ableiten.
Am häufigsten kommen derzeit folgende Präparate zum Einsatz:
Semaglutid (Ozempic®, Wegovy®):
Semaglutid hat eine lange Halbwertszeit (~7 Tage), wird 1× wöchentlich s.c. appliziert und ist besonders gut dokumentiert hinsichtlich kardiovaskulärer Effekte, Gewichtsreduktion und neuroprotektiver Potenziale.
Einstiegsdosis: 0,25 mg 1×/Woche für mindestens 4 Wochen
Steigerung: bei guter Verträglichkeit auf 0,5 mg/Woche möglich
Langfristige Zieldosis bei Long COVID/ME/CFS (off-label): oft 0,25–0,5 mg/Woche, deutlich niedriger als bei Adipositas (dort bis 2,4 mg/Woche)
→ Vorteil: sehr gute Verträglichkeit bei niedriger Dosis, lange Wirkdauer, gute Datenlage
Liraglutid (Saxenda®, Victoza®):
Liraglutid ist täglich zu injizieren, hat eine kürzere Halbwertszeit und wird in der neurologischen Long-COVID-Forschung (z. B. bei kognitivem Fatigue-Syndrom) eingesetzt.
Einstiegsdosis: 0,6 mg s.c. 1×/Tag
Steigerung: wöchentlich um 0,3 mg bis max. 1,8 mg/Tag (bei Diabetes) oder 3,0 mg (bei Adipositas)
Für Long COVID/ME/CFS: meist 0,6–1,2 mg/Tag ausreichend, ggf. an individuelle Verträglichkeit anpassen
→ Vorteil: möglich bei kognitiven Symptomen, flexibel dosierbar, schnelleres Absetzen bei NW möglich
Tirzepatid (Mounjaro®, Zepbound®):
Tirzepatid ist ein dualer GIP/GLP-1-Agonist mit noch stärkeren metabolischen Effekten, aber auch höherem Risiko für gastrointestinale Nebenwirkungen. Einige Einzelfallberichte deuten auf positive Effekte auch bei therapierefraktärem Long COVID.
Einstiegsdosis: 2,5 mg 1×/Woche
Steigerung: sehr vorsichtig; klinischer Einsatz meist bei metabolischem Phänotyp
→ Aktuell nicht erste Wahl bei ME/CFS oder stark sensitivem vegetativem Nervensystem
Zusätzliche Hinweise zur Dosierung:
Die für Long COVID/ME/CFS empfohlenen Dosen liegen deutlich unter den üblichen Dosen zur Gewichtsreduktion. Ziel ist nicht primär die Gewichtsabnahme, sondern eine modulierte Immun-, Gefäß- und Neurofunktion.
Eine sehr langsame Dosissteigerung (z. B. 4–8 Wochen auf einer Startdosis bleiben) reduziert das Risiko von Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen oder Hypotonie.
Bei starker Symptomlast, z. B. Fatigue, orthostatische Intoleranz oder MCAS-Phänotyp, wird meist Semaglutid 0,25 mg/Woche über längere Zeit beibehalten, ohne Titrierung.
Zur Anwendung werden GLP1-Agonisten einmal wöchentlich subkutan injiziert – idealerweise immer am selben Wochentag, unabhängig von Mahlzeiten.
Was sind die Kosten für eine Therapie?
Da GLP‑1‑Agonisten in Deutschland für Long-COVID oder ME/CFS off‑label eingesetzt werden, müssen die Kosten in der Regel selbst getragen werden. Hier ein Überblick über typische Preise in Deutschland:
Semaglutid (Wegovy / Ozempic)
Starterdosis 0,25 mg/Woche: Der Preis für einen Monat (4 Injektionen) bei etwa 171,92 € für 28 Tage, also etwa 43 €/Injektion .
Erhaltung bei 2,4 mg/Woche (Maximaldosis Adipositas): ca. 328 €/Monat .
Fazit: Für die im Off‑Label‑Setting übliche Dosis von 0,25–0,5 mg/Woche liegt der Selbstzahlerpreis bei ca. 43–86 €/Injektion, also 172–344 €/Monat.
Liraglutid (Saxenda / Victoza)
In Deutschland kostet eine Packung mit 5 Pens (3 mg) – ausreichend für ca. 5 Wochen bei Vollerhaltungsdosis – ungefähr 289 € .
Das entspricht einer Doseneinheit von 3 mg/Tag – im Einsatz bei ME/CFS werden typischerweise 0,6–1,2 mg/Tag genutzt, wodurch sich die monatlichen Kosten anteilig auf ca. 60–120 € reduzieren könnten, je nach genauem Verbrauch.
Tirzepatid (Mounjaro)
2,5 mg/Woche (Starterdosis): Der Listenpreis für eine Einzelpackung mit einer 2,5‑mg‑Dosierung liegt bei 206 € pro Monat (für einen Fertigpen mit vier Dosen, also 4 Wochen) .
Eine Steigerung je nach Verträglichkeit ist lässt die Kosten ansteigen.
Fazit:
GLP-1-Rezeptoragonisten, ursprünglich zur Behandlung von Typ-2-Diabetes und Adipositas entwickelt, rücken zunehmend auch bei postinfektiösen Erkrankungen wie Long-COVID und ME/CFS in den Fokus – obwohl sie bislang nicht dafür zugelassen sind. Erste klinische Erfahrungsberichte zeigen, dass eine selektierte Patient:innengruppe mit metabolischer Belastung, Mastzellaktivierung oder neurokognitiven Einschränkungen möglicherweise von der entzündungsmodulierenden, neuroprotektiven und sympathikusregulierenden Wirkung der GLP-1-Agonisten profitieren kann. Dabei reichen bereits sehr niedrige Dosierungen – oft unterhalb der on-label-Einsatzbereiche – aus, um potenzielle Effekte zu beobachten.
Dennoch handelt es sich um einen experimentellen Therapieansatz, der derzeit ausschließlich off-label erfolgt. Die bisherigen Daten basieren überwiegend auf Einzelfallberichten; valide randomisierte Studien fehlen bislang. Erste kontrollierte Studien sind jedoch in Planung oder bereits angelaufen, insbesondere mit Liraglutid bei Long-COVID-bedingtem Brain Fog. Die nächsten Jahre werden zeigen, ob sich GLP-1-Agonisten als ein evidenzbasierter Therapiebaustein bei Long-COVID oder ME/CFS etablieren können – oder ob die beobachteten Effekte Einzelfälle bleiben.
Bis dahin gilt: Der Einsatz sollte individuell geprüft, ärztlich eng begleitet und insbesondere auf Patient:innen mit passendem Profil (z. B. metabolisches Syndrom, inflammatorische Komorbiditäten, Mastzellaktivierung) beschränkt bleiben.
Quellen:
Drucker, D. J. (2018). Mechanisms of action and therapeutic application of glucagon-like peptide-1. Cell Metabolism, 27(4), 740–756.
Drucker, D. J. (2022). GLP-1–based therapies for the treatment of obesity and type 2 diabetes: Past, present, and future. Cell Metabolism, 36(1), 1–16.
Nauck, M. A., & Meier, J. J. (2019). Incretin hormones: Their role in health and disease. Diabetes, Obesity and Metabolism, 21(S1), 5–21.
Chao, A. M., Wadden, T. A., Tronieri, J. S., Berkowitz, R. I., & Alamuddin, N. (2023). Liraglutide and semaglutide: Anti-obesity agents that improve cognition? Nature Reviews Endocrinology, 19, 10–12
ClinicalTrials.gov. (2023). GLP-1 Receptor Agonist Treatment for Cognitive Impairment in Long COVID (NCT06171152). National Library of Medicine.
Whittington, M. D., et al. (2023). Cost-effectiveness and value assessment of tirzepatide for patients with type 2 diabetes and obesity. JAMA Network Open, 6(2), e2252481.
Basina, M., et al. (2021). Potential benefits of GLP-1 receptor agonists in people with fibromyalgia: A mechanistic hypothesis. Frontiers in Pharmacology, 12, 786143.
Fallberichte & klinische Erfahrungen:
Kaufman, D., & Ruhoy, I. (2023). GLP-1 receptor agonists in ME/CFS and Long COVID: Observations from clinical practice. (Manuskript in Vorbereitung; erwähnt in Vorträgen der MASTERMinds-Reihe).
Patientinnenbericht Mastzellsyndrom & Semaglutid. (2023). In: mastcell360.com. https://mastcell360.com (Fallbericht, nicht peer-reviewed; Erfahrungsbericht einer Patientin)
Preise & Medikamente (Stand: 2025):
Apotheke Adhoc. (2024, März). Mounjaro wird teurer – Preisübersicht GLP-1-Agonisten in Deutschland. https://www.apotheke-adhoc.de
PharmaLive. (2023, Juli). Novo Nordisk prices Wegovy weight-loss drug for German launch. https://www.pharmalive.com/novo-nordisk-prices-wegovy-weight-loss-drug-for-german-launch/
Moz.de. (2024, März). Mounjaro Preis 2025 – Wie viel kostet die Alternative zu Wegovy und Ozempic? https://www.moz.de
Medipreis. (2024). Mounjaro online kaufen – Preisübersicht. https://www.medipreis.de
Zusätzliche Fachinformationen:
Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG). (2023). Leitlinien zur Therapie des Typ-2-Diabetes mit GLP-1-Rezeptoragonisten. https://www.deutsche-diabetes-gesellschaft.de
NICE. (2022). GLP-1 receptor agonists for the treatment of obesity and related conditions: Evidence summary. National Institute for Health and Care Excellence. https://www.nice.org.uk



Kommentare